SAN DIEGO – 50 Jahre nach jenem Krieg, der die Karriere Golda Meirs als israelische Premierministerin beendete, ist nun ein Film über die Politikerin mit Helen Mirren in der Hauptrolle angelaufen. Der noch auf seinen deutschsprachigen Kinostart wartende Film Golda zeichnet das Bild einer ununterbrochen Chesterfield rauchenden Protagonistin, die mit einer zeitnah eintretenden Lektion der Diplomatie Bekanntschaft machte: um wirkungsvoll zu agieren, müssen sich Staats- und Regierungschefs nicht nur über die Persönlichkeit des Gegenübers im Klaren zu sein, sondern auch über dessen nationale Interessen.
Amerika hat es immer dann vermasselt, wenn seine Präsidenten diese zwei Dinge verwechselten. Präsident Barack Obama glaubte, den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad durchschaut zu haben, als er ihn warnte, mit dem Einsatz von Chemiewaffen würde er eine „rote Linie“ überschreiten. Assad hatte dafür nur Hohn und Spott übrig und setzte diese Waffen trotzdem ein. Russlands Präsident Wladimir Putin witterte Schwäche und nahm die Krim geradezu im Stechschritt ein.
Donald Trump verwechselte seine persönliche Beziehung zu Nordkoreas Kim Jong-un mit Politik, als er frohlockte, dass ein „schöner“ Brief des Diktators die Dynamik der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea verändert habe. Und Präsident Joe Biden dachte, er hätte die Taliban im Griff, als er den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan befahl. Dem war aber nicht so, und Amerikas überstürzter Abzug hinterließ todbringende Black Hawk- und Apache-Hubschrauber in der Gewalt eines barbarischen Regimes.
Wie ist das nun mit Meir? Die Einwanderin aus Russland hätte im amerikanischen Milwaukee ein komfortables Leben führen können. Als Jahrgangsbeste ihrer High-School-Klasse organisierte sie einmal eine Spendenaktion, um Bücher für arme Flüchtlingskinder zu kaufen. Doch um Komfort ging es ihr nicht und so zog sie 1921 nach Tel Aviv und mühte sich durch die schwierigen Anfangsjahre Israels.
Meir erlebte in Israel eine Dürre, die Bauern um Wasser betteln ließ. Sie hielt einen Zivilisten im Arm, der an einer Schussverletzung starb. Und sie erlebte, wie britische Soldaten Holocaust-Überlebende zurückwiesen, die nun wieder in Internierungslagern landen würden.
Meir hatte große Tränensäcke unter ihren Augen – wie zum Beweis dafür, was diese schon alles gesehen hatten. Als sie 1969 zur israelischen Premierministerin vereidigt wurde, sah sie dem ausgelaugten Lyndon Johnson verblüffend ähnlich, der gerade seine Amtszeit als US-Präsident beendet hatte (wenngleich Meir 40 Zentimeter kleiner war).
Männliche Zionisten konnten durchaus chauvinistisch sein. Der Komiker Jackie Mason scherzte einmal, israelische Männer sähen so braungebrannt und machohaft aus, dass er sicher sei, sie wären Puerto-Ricaner. Meir weigerte sich jedoch, bei Sitzungen in die Damenecke verbannt zu werden. Sie stieg zur wichtigsten Beraterin des ersten israelischen Premierministers David Ben-Gurion auf, der sie als „den besten Mann in meinem Kabinett“ bezeichnete.
Nach Israels Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1948 beauftragte Ben-Gurion Meir mit der Leitung der Verteidigung Jerusalems und der Lebensmittelverteilung. Sie ordnete eine tägliche Zuteilung von nur 85 Gramm Trockenfisch, Linsen, Makkaroni und Bohnen an. Unter Schlafmangel leidend, absolvierte sie häufig den Spießrutenlauf von Jerusalem nach Tel Aviv. Eines Tages, als ihr Bus unter Beschuss genommen wurde, deckte sie ihre Augen ab. Nach dem Grund dafür gefragt, antwortete sie: „Ich habe eigentlich keine Angst vor dem Tod. ... Aber wie soll ich leben, wenn ich blind bin? Wie soll ich arbeiten?“ Einige Tage später geriet ihr Bus in einen Hinterhalt, als er vor den Toren Jerusalems um eine Kurve fuhr. Der Mann auf dem Sitz neben ihr starb in ihrem Schoß.
Kluge, starke Männer fanden sie ansprechend. US-Präsident Richard Nixon überwand seine psychologischen Dämonen und zeigte ihr seine selten zur Schau gestellte warmherzige Seite. Er setzte sich außerdem über Außenminister Henry Kissinger hinweg, um Meirs Wünsche als Premierministerin in Kriegszeiten zu erfüllen.
Kissinger hatte gezaudert, Israel während des Überraschungsangriffs an Jom Kippur 1973 zu helfen, als ägyptische Streitkräfte die israelische Luftwaffe mit neuen sowjetischen Flug- und Panzerabwehrraketen lahmlegten. Nixon sagte schließlich: „Hör zu, Henry, sie werden uns immer gleich viele Vorwürfe machen, egal, ob wir drei oder dreißig oder hundert Maschinen schicken... also schick alles, was fliegt.”
Noch faszinierender präsentierten sich Meirs enge Beziehungen zu Jordaniens König Abdallah und dessen Enkel Hussein, mit denen sie sich heimlich zu direkten und freundschaftlichen Gesprächen traf. Kurz vor der Unabhängigkeitserklärung Israels fuhr sie klammheimlich zur jordanischen Grenze, zog dort ein schwarzes Kleid und einen Schleier über und setzte ihre Fahrt mit dem königlichen Chauffeur zu einem geschützten Anwesen in den Bergen fort. „Warum haben es die Juden mit der Staatsgründung so eilig?“ fragte der König. „Wir haben zweitausend Jahre gewartet. Ich würde das nicht als Eile definieren“, antwortete sie.
Als Hussein später König wurde, entwickelte er eine enge persönliche Beziehung zu Meir. Im Jahr 1970 ersuchte er sie, die israelische Luftwaffe anzuweisen, syrische Panzer an der jordanischen Grenze zu zerstören, woraufhin sich die Syrer angesichts dieser Bedrohung zurückzogen. Manchmal reiste er auch heimlich nach Israel, um sie zu besuchen, wobei er seinen eigenen Bell-Hubschrauber steuerte und an einem Treffpunkt in der Nähe des Toten Meeres landete. Wenige Tage vor dem Jom-Kippur-Krieg 1973 flog er zu einem gesicherten Mossad-Haus, um sie vor einem möglichen Angriff zu warnen. Meir und Hussein bedauerten, dass er nicht über genügend Einfluss verfügte, um ein umfassendes israelisch-arabisches Friedensabkommen auszuhandeln. Schwere Verluste im Krieg von 1973 kosteten sie das Amt der Premierministerin.
Vier Jahre später, als der ägyptische Präsident Anwar Sadat seine mutige Reise nach Israel antrat und vor der jubelnden Knesset erklärte dass „wir Sie herzlich einladen, mit uns in Frieden zu leben“, wartete Meir beim Empfang in der Schlange. Die beiden tauschten Wangenküsse aus und scherzten darüber, Großeltern zu werden. Jahre zuvor war Meir überzeugt gewesen, dass Sadat ein Friedensstifter sein könnte. In diesem Augenblick, ein Jahr vor ihrem Krebstod, bekam sie letztendlich Recht.





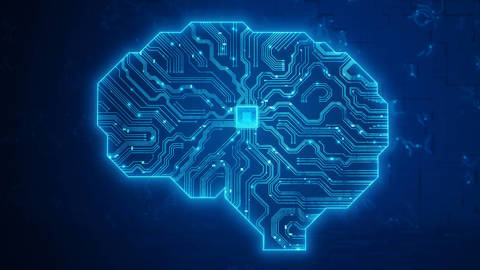





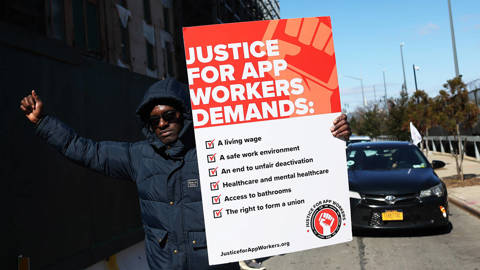
SAN DIEGO – 50 Jahre nach jenem Krieg, der die Karriere Golda Meirs als israelische Premierministerin beendete, ist nun ein Film über die Politikerin mit Helen Mirren in der Hauptrolle angelaufen. Der noch auf seinen deutschsprachigen Kinostart wartende Film Golda zeichnet das Bild einer ununterbrochen Chesterfield rauchenden Protagonistin, die mit einer zeitnah eintretenden Lektion der Diplomatie Bekanntschaft machte: um wirkungsvoll zu agieren, müssen sich Staats- und Regierungschefs nicht nur über die Persönlichkeit des Gegenübers im Klaren zu sein, sondern auch über dessen nationale Interessen.
Amerika hat es immer dann vermasselt, wenn seine Präsidenten diese zwei Dinge verwechselten. Präsident Barack Obama glaubte, den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad durchschaut zu haben, als er ihn warnte, mit dem Einsatz von Chemiewaffen würde er eine „rote Linie“ überschreiten. Assad hatte dafür nur Hohn und Spott übrig und setzte diese Waffen trotzdem ein. Russlands Präsident Wladimir Putin witterte Schwäche und nahm die Krim geradezu im Stechschritt ein.
Donald Trump verwechselte seine persönliche Beziehung zu Nordkoreas Kim Jong-un mit Politik, als er frohlockte, dass ein „schöner“ Brief des Diktators die Dynamik der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea verändert habe. Und Präsident Joe Biden dachte, er hätte die Taliban im Griff, als er den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan befahl. Dem war aber nicht so, und Amerikas überstürzter Abzug hinterließ todbringende Black Hawk- und Apache-Hubschrauber in der Gewalt eines barbarischen Regimes.
Wie ist das nun mit Meir? Die Einwanderin aus Russland hätte im amerikanischen Milwaukee ein komfortables Leben führen können. Als Jahrgangsbeste ihrer High-School-Klasse organisierte sie einmal eine Spendenaktion, um Bücher für arme Flüchtlingskinder zu kaufen. Doch um Komfort ging es ihr nicht und so zog sie 1921 nach Tel Aviv und mühte sich durch die schwierigen Anfangsjahre Israels.
Meir erlebte in Israel eine Dürre, die Bauern um Wasser betteln ließ. Sie hielt einen Zivilisten im Arm, der an einer Schussverletzung starb. Und sie erlebte, wie britische Soldaten Holocaust-Überlebende zurückwiesen, die nun wieder in Internierungslagern landen würden.
Meir hatte große Tränensäcke unter ihren Augen – wie zum Beweis dafür, was diese schon alles gesehen hatten. Als sie 1969 zur israelischen Premierministerin vereidigt wurde, sah sie dem ausgelaugten Lyndon Johnson verblüffend ähnlich, der gerade seine Amtszeit als US-Präsident beendet hatte (wenngleich Meir 40 Zentimeter kleiner war).
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
Männliche Zionisten konnten durchaus chauvinistisch sein. Der Komiker Jackie Mason scherzte einmal, israelische Männer sähen so braungebrannt und machohaft aus, dass er sicher sei, sie wären Puerto-Ricaner. Meir weigerte sich jedoch, bei Sitzungen in die Damenecke verbannt zu werden. Sie stieg zur wichtigsten Beraterin des ersten israelischen Premierministers David Ben-Gurion auf, der sie als „den besten Mann in meinem Kabinett“ bezeichnete.
Nach Israels Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1948 beauftragte Ben-Gurion Meir mit der Leitung der Verteidigung Jerusalems und der Lebensmittelverteilung. Sie ordnete eine tägliche Zuteilung von nur 85 Gramm Trockenfisch, Linsen, Makkaroni und Bohnen an. Unter Schlafmangel leidend, absolvierte sie häufig den Spießrutenlauf von Jerusalem nach Tel Aviv. Eines Tages, als ihr Bus unter Beschuss genommen wurde, deckte sie ihre Augen ab. Nach dem Grund dafür gefragt, antwortete sie: „Ich habe eigentlich keine Angst vor dem Tod. ... Aber wie soll ich leben, wenn ich blind bin? Wie soll ich arbeiten?“ Einige Tage später geriet ihr Bus in einen Hinterhalt, als er vor den Toren Jerusalems um eine Kurve fuhr. Der Mann auf dem Sitz neben ihr starb in ihrem Schoß.
Kluge, starke Männer fanden sie ansprechend. US-Präsident Richard Nixon überwand seine psychologischen Dämonen und zeigte ihr seine selten zur Schau gestellte warmherzige Seite. Er setzte sich außerdem über Außenminister Henry Kissinger hinweg, um Meirs Wünsche als Premierministerin in Kriegszeiten zu erfüllen.
Kissinger hatte gezaudert, Israel während des Überraschungsangriffs an Jom Kippur 1973 zu helfen, als ägyptische Streitkräfte die israelische Luftwaffe mit neuen sowjetischen Flug- und Panzerabwehrraketen lahmlegten. Nixon sagte schließlich: „Hör zu, Henry, sie werden uns immer gleich viele Vorwürfe machen, egal, ob wir drei oder dreißig oder hundert Maschinen schicken... also schick alles, was fliegt.”
Noch faszinierender präsentierten sich Meirs enge Beziehungen zu Jordaniens König Abdallah und dessen Enkel Hussein, mit denen sie sich heimlich zu direkten und freundschaftlichen Gesprächen traf. Kurz vor der Unabhängigkeitserklärung Israels fuhr sie klammheimlich zur jordanischen Grenze, zog dort ein schwarzes Kleid und einen Schleier über und setzte ihre Fahrt mit dem königlichen Chauffeur zu einem geschützten Anwesen in den Bergen fort. „Warum haben es die Juden mit der Staatsgründung so eilig?“ fragte der König. „Wir haben zweitausend Jahre gewartet. Ich würde das nicht als Eile definieren“, antwortete sie.
Als Hussein später König wurde, entwickelte er eine enge persönliche Beziehung zu Meir. Im Jahr 1970 ersuchte er sie, die israelische Luftwaffe anzuweisen, syrische Panzer an der jordanischen Grenze zu zerstören, woraufhin sich die Syrer angesichts dieser Bedrohung zurückzogen. Manchmal reiste er auch heimlich nach Israel, um sie zu besuchen, wobei er seinen eigenen Bell-Hubschrauber steuerte und an einem Treffpunkt in der Nähe des Toten Meeres landete. Wenige Tage vor dem Jom-Kippur-Krieg 1973 flog er zu einem gesicherten Mossad-Haus, um sie vor einem möglichen Angriff zu warnen. Meir und Hussein bedauerten, dass er nicht über genügend Einfluss verfügte, um ein umfassendes israelisch-arabisches Friedensabkommen auszuhandeln. Schwere Verluste im Krieg von 1973 kosteten sie das Amt der Premierministerin.
Vier Jahre später, als der ägyptische Präsident Anwar Sadat seine mutige Reise nach Israel antrat und vor der jubelnden Knesset erklärte dass „wir Sie herzlich einladen, mit uns in Frieden zu leben“, wartete Meir beim Empfang in der Schlange. Die beiden tauschten Wangenküsse aus und scherzten darüber, Großeltern zu werden. Jahre zuvor war Meir überzeugt gewesen, dass Sadat ein Friedensstifter sein könnte. In diesem Augenblick, ein Jahr vor ihrem Krebstod, bekam sie letztendlich Recht.